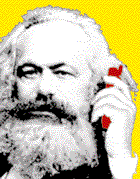Wer wissen möchte, wie kapitalistisches In-der-Umwelt-Sein bzw.kapitalistische Umweltverhältnisse mit mangelndem Umweltbewusstsein bzw. -verhalten zusammenhängen, kommt um Marx Abhandlungen über den Fetischcharakter der Ware nicht herum.
Wie die (aus den privateigentümlichen Produktions- bzw. Aneignungsweisen unweigerlich hervor gehende) „Wahrnehmung sozialer Verhältnisse als Verhältnis von Sachen“ entsprechend beschränktes Verantwortungs- oder (Un-) Rechtsbewusstsein hervor bringt und was gegen den Warensinn helfen könnte ist in dem Beitrag „Sind wir des Warensinns?“ behandelt.
Die Auseinandersetzung mit dem Fetischcharakter kann allerdings auch ganz seltsame Blüten treiben. In seinem 2002 erschienenen Aufsatz „Das Fetischismus-Konzept von Marx und sein Kontext“ äußert sich der Lehrstuhlinhaber des Kulturwissenschaftlichen Seminars der HU Berlin, Professor Dr. Böhme, begeistert über „Marx Fetisch-Konzept“. Das zeige nämlich, dass auch „die Moderne“ im Kern irrational und die einstige Verachtung afrikanischer Fetisch-Rituale deshalb wohl nur eine Projektion katholisch sozialisierter Euro-Zentristen gewesen sei. Soweit so gut! Erkenntnisreich beschreibt Böhme z.B. die Geschichte dieser Projektion und zeigt wie in manchen ländlichen Regionen Afrikas Fetischrituale eine soziale Verständigungsgrundlage schaffen, auf deren Basis der dem Fetisch verliehene Zauber tatsächlich wirkt.
Doch genau so stellt sich Böhme offenbar auch den Wirkungszusammenhang des „Warenzaubers“ der bürgerlichen Welt vor. Marx Erläuterungen der Voraussetzungen, Mechanismen und Probleme der verkehrten Wahrnehmung sozialer Verhältnisse als Verhältnisse von Sachen vollzieht Böhme nicht nach. So sieht er auch nicht, dass deren Witz es gerade ist, dass diese unabhängig vom Willen (und den psychischen Motiven) der Menschen immer aufs Neueaus den privateigentümlichen Formen kapitalistischer Vergesellschaftung hervorgehen.
Stattdessen unterstellt Böhme nun Marx, der seiner Meinung nach hier „alles durcheinander bringt „, (?) mittels geschickter Rhetorik und Metaphorik „ohne Zweifel“ erst die verzauberte Welt des Kapitalfetischs geschaffen, und lediglich seine eigene „Fetischisierung des Warenfetisch“ auf die „der Moderne“ projiziert zu haben.
Auf die skurrilen Einzelheiten der Böhmschen Vorstellung von der „Materialisierung“ marxscher Ideen näher einzugehen, fehlt es mir derzeit leider an Muße. Es sei aber auf die wunderbare Kritik von Ingo Elbe verwiesen: Hartmut Böhme: Fetischismus und Kultur. Eine andere Theorie der Moderne
Die Böhm‘ schen Projektionen zeigen, wie schwer es gerade für „Bewusstseinsarbeiter“ ist, sich ein Bewusstsein davon zu erarbeiten, was es für das eigene Erkenntnisvermögen bedeutet, wenn die Notwendigkeit fehlt, sich die Einzelheiten der – sich unter kapitalistischen Behauptungsbedingungen unwillkürlich hinter den Rücken der Akteure herstellenden – Vergesellschaftung durch den Kopf gehen zu lassen.
Das wird auch dadurch erschwert, dass die privateigentümlich kopflose Form der Arbeitsteilung dafür sorgt, dass auch die als Vergesellschaftungs-Vorstellungs-Mittel fungierenden Begriffe ihre Funktion als mehr oder minder passende „Griffe an der Wirklichkeit zu ihrer besseren Handhabung“ nicht hinreichend erfüllen können.
Es versteht sich, daß die Aufhebung der Entfremdung immer von der Form der Entfremdung aus geschieht
Marx: Ökonomisch-philosophische Manuskripte aus dem Jahre 1844.MEW Bd. 40, S. 553
Begriffe wie “Freiheit”, “Gerechtigkeit”, “Entfremdung” ” Kapitalismus” , “Sozialismus”, “Produktivkräfte”, “Fortschritt”, “Entwicklung”, “Natur”, “Politik”, “Gott”, “Rationalität”, “Bedarf”, “Bedürfnisse”,” Selbstbestimmung” oder auch “Fetischisierung” erscheinen uns als Fixsterne des Denkens und Handelns!
Sie gelten als die wahren Mittel der Erleuchtung oder zumindest der Beleuchtung des Elends dieser Welt und wie dem zu begegnen sei. Da sie der Orientierung dienen, ist deren Deutung – oft hart manchmal blutig – umkämpft. Sie stehen für Protest gegen wirkliches Elend, für Seufzer bedrängter Kreaturen, sind Herz ungemütlicher Zeiten und Geist geistloser Zustände (vgl . MEW Bd. 1, S. 378) Manchen versetzt ihr Gebrauch in einen wohligen Rausch. Aber Vorsicht! Vor Halluzinationen wird gewarnt.
Fern aller konkreten Beziehungen, Interessen und Instinkte wirklicher Menschen und deren Behauptungsbedingungen beginnen uns diese mit eigenem Geist beseelt vorgestellte Erscheinungen auf der Nase herum zu tanzen und dem menschlichen Denken und Handeln mal diesen und mal jenen Geruch zu verleihen ohne dass sich deren Spur ins alltägliche Leben konkret nachvollziehen ließe.
Um so besser kann ihr geschickter Gebrauch Flügel und übermenschliche Kräfte verleihen, die Menschen fesseln, ihnen Orientierung geben und an der Nase herum führen. Doch nachhaltiges „Uns-aus-dem-Elend-zu-erlösen“ funktioniert so sicher nicht.
Was tun?!
Wie der Warenfetisch lässt sich ein dem sozialen Kontext entfremdeter Begriffsfetischismus nicht einfach aus dem Kopf schlagen. Das mag auch nicht in jedem Fall notwendig sein. Mit Hilfe der genannten Mittel der Orientierung (innnerhalb orientierungsloser Verhältnisse) lassen sich viel gute Dinge anstellen und alles ist halt eine Frage sozialer Kämpfe um Deutungsmacht.
Doch bei allem gebotenen Realismus: ein rationaler Diskurs, die Konstruktion einer „idealen Diskursgemeinschaft“ braucht eine Entfetischisierung der sprachlichen Wahrnehmungsmittel. Aber wie soll das gehen?
Faustregel: Um so klarer ihr Kontext, desto handhabbarer wird die begriffliche Erfassung der Wirklichkeit.
Nichts gegen „Entzauberung“ etwa eines trotz (oder wegen?) einer imperialistische Praxis spirituell aufgeladenen Begriffs von „Rationalität“!
Aber was hilft es, „die Rationalistät“ oder (auch sehr beliebt, aber doppelt mystifizierend) „die westliche Rationalität“ etwa für Prozesse der Verdrängung von lokal angepassten Wirtschaftsweisen mit hoher Agrobiodiversität verantwortlich zu machen? Welche Konsequenzen außer hilfloses Geister-Abschwören und Begriffs-Verteufelungen aller Art ergeben sich aus einer solchen Ursachenbestimmung?
Um dennoch den Tatsachen auf der Spur zu kommen, muss zumindest danach gefragt werden, in welcher Hinsicht und für welchen (und wessen) Zweck (oder Zeitrahmen) ein bestimmter Gedanke, Plan, Spielraum, eine bestimmte Methode, Produktionsweise oder auch ein bestimmtes Gefühl zweckdienlich und deshalb rational ist Und in welcher Hinsicht usw. nicht?
These: Alle Rationalität ist Zweckrationalität.
Selbst die sprichwörtliche Blindheit und zeitverschwenderische Verrücktheit Liebender oder der Spaß an künstlerischer Freiheit folgt mehr oder minder bestimmbaren Zwecken. Furztrockenheit und offensichtliche Berechnung wäre hier wenig rational.
Rationaler Diskurs und Entfetischisierung brauchen eine andere Art der Arbeitsteilung
Fehlt es an Möglichkeiten und wird keine Notwendigkeit gesehen, die Entwicklung und Anwendung der menschlichen Lebens- und Bereicherungsmittel miteinander abzustimmen, erscheint das spezifisch Menschliche, nämlich Arbeit nicht als freie Umgestaltung der Umwelt zu einem vorher (mit-)bestimmten sozialen Zweck sondern als eine fremde, unbeherrschbare Angelegenheit, deren Ergebnisse und Voraussetzungen einem nichts angehen.
Sozialismus hieße Verallgemeinerung des Vermögens, nach den sozialen Zwecken und den für deren Erfüllung notwendigen bzw. zu akzepzierenden Kosten des eigenen Tuns zu fragen, danach gefragt zu werden und als ein das lokale und globale Miteinander aktiv mitgestaltender Mensch gefragt zu sein. Nur in so weit die Individuen in entsprechende Rechtfertigungsverhältnissen hinein sozialisiert werden können und sich in ihnen behaupten müssen, können die individuellen Fähigkeiten, Bedürfnisse und Taten als gesellschaftlich bewusste Produuktivkräfte eingebracht (und behandelt) werden. Die Phrasen vom Selbstzweck hören auf und gemeinschaftliches (auch weltgemeinschaftliches) Zwecksetzen tritt an deren Stelle.
„Freiheit“, „Gleichheit“, „Geschwisterlichkeit“ waren die gedanklichen Fixsterne der menschlichen Emanzipation in den Grenzen des Warenverkehrs. Von nun an geht es um die Erarbeitung der Möglichkeit, als frei assoziierte Persönlichkeiten und Zusammenschlüsse gesamtgesellschaftlich rational denken und handeln zu können.
hh



 Veröffentlicht von Hans-Hermann Hirschelmann
Veröffentlicht von Hans-Hermann Hirschelmann