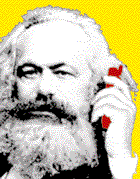Über strukturelle Voraussetzungen eines hinreichenden Bedürfnisses zur Verbraucheraufklärung
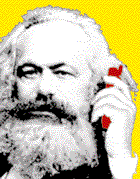
Wer die Wahrheit übers unmittelbare Leben erfahren will, muß dessen entfremdeter Gestalt nachforschen, den objektiven Mächten, die die individuelle Existenz bis ins Verborgenste bestimmen.
Theodor W. Adorno Minima Moralia, Reflexionen aus dem beschädigten Leben
„… der Kapitalismus ist schon in der Grundlage aufgehoben durch die Voraussetzung, daß der Genuß als treibendes Motiv wirkt, nicht die Bereicherung selbst.
Marx: Das Kapital, MEW Bd. 24, S. 123
Bei der Suche nach Antworten auf Fragen nach strukturellen Hintergründen einer bornierten „Geiz ist geil“ Moral gehören Marx Ansichten des Fetischcharakters der Ware“ auf den Tisch, der „sobald er als Ware auftaucht, auf dem Kopf zu stehen scheint und aus seinem Holzkopf heraus Grillen entwickelt“.
In der Regel müssen moderne Bürger von Welt das zum guten Leben Notwendige weder eigenhändig der Natur ihrer unmittelbaren Umwelt abtrotzen noch müssen sie für die sozialen bzw. ökologischen Kosten gerade stehen, die das Abtrotzen mit sich bringt. Die Kaufkräftigen aller Länder scheinen auf Ewig von der Sorge befreit, ob und wie sie es schaffen, die Kräfte der Natur für die eigenen Nachkommen zu bewahren oder anzureichern. Stets volle Regale bieten keinen Anlass, sich um die Zukunftsfähigkeit der Naturkräfte zu sorgen, die das Begehrte auf ewig zuverlässig bereit zu stellen scheinen.
Auch der kleine Bürger-König-Kunde von der Straße profitiert – zunächst- von Überfischung, Bodenverwüstung oder dem Raubbau an menschlicher Arbeitskraft. Aus Sicht eines Großeinkäufers, Weiterverarbeiters oder Endverbrauchers scheinen unangenehme Folgen der Übernutzung von Naturkräften auszubleiben, solange sie durch die Erschließung immer neuer Quellen des Wohlstandes kompensiert werden können. Natürliche Grenzen des „Nachwachstums“ scheinen aufgehoben.
Endstation Warensinn?
Die vom Politikwissenschaftler Francis Fukuyama geäußerte Vorstellung vom „Ende der Geschichte“ lebt möglicherweise von dieser Illusion. Warenverkehr versetzt das moderne Bewusstsein in in eine bequeme Lage. Das Losgelöstsein von der Last der Wahrnehmung unangenehmer Voraussetzungen oder Wirkungen des Konsumierens bestimmt offenbar auch den Horizont des philosophischen Zeitgeist, der nicht sieht, dass häufig kein Gras, (Regenwald oder Fisch) mehr nachwächst, wo menschlicher Fortschritt auftritt und sich das unbekümmert als ewiger Kreislauf vorgestellte „Ende der Menschheitsgeschichte“ in einer ökologischen Abwärtsspirale bewegt.
Vielleicht war Karl Marx hier doch weitsichtiger. Für ihn beginnt (!) die Geschichte der Menschheit erst, wenn die entscheidenden Fragen des „Was?“, „Wer?“, „Wo?“, „Wie?“, Wieviel?“, „Wem?“ und „Warum?“ der Produktion – im Großen und Ganzen – in gemeinsamen Abwägungsprozessen entschieden werden können und müssen. Nur in so weit die Menschen die Freiheit besitzen, sich gegenseitig zu nötigen, die soziale und ökologische Vernunft (Verträglichkeit, Nachhaltigkeit) der beabsichtigten Produktionsziele und -methoden zu belegen, kann von einer wirklich gemeinsam handelnden „Menschheit“ die Rede sein. Wie viel Marktwirtschaft zur Herstellung einer solcherart gemeinsam handelnden Menschheit möglich oder auch notwendig ist, mag dahin gestellt sein. Fest steht: Solange eine in ihrer sozialen und ökologischen Wirkung weitgehend blinde Konkurrenz (und damit vor allem die Einsparung von Arbeitsaufwand) die Entscheidungen der Menschen über den Erfolg der Produktion (und damit de Vorsellungen ber deren „Richtigkeit“ bzw. „Rationalität“) bestimmen, treibt das den menschlichen Reichtum in einem unangenehmen Sinne „wie verrückt“ voran! Denn das Verrückte ist, dass den beteiligten Menschen der letztlich bewirkte Schaden (oder Nutzen) herzlich egal bleiben kann, solange sie selbst nicht unmittelbar betroffenen sind. Solange und soweit produzierter Nutzen (oder Schaden) jedoch als Privatsache gelten (kann), scheint auch das philosophische Denken vom Warensinn getrübt.
Geld stinkt nicht .
Warum rebelliert das menschliche (Un-) Rechtsbewusstsein so selten gegen das leichtfertige in Kauf nehmen selbst schwerer Verbrechen im Wortsinne mörderischer Produktionsbedingungen? Vielleicht fehlt es einfach an genau diesen Möglichkeiten, Produktion und Konsum gemeinsam, nach (welt-) gemeinschaftlich reflektierten Kriterien zu steuern. Denn ohne dem kann jedes Glied der globalen Produktions- und Konsumketten nur seinen borniert-privaten Vorteil (oder Nachteil) sehen mit der Folge, dass das durch Raubbau am Meer gewonnene Mehr an Meeresfruchtpizza sogar als Zugewinn an Gerechtigkeit erscheint.
Denn für mich sieht es so aus: ich habe mir die Pizza durch Arbeit redlich verdient. Ein Mehr an Pizza für das gleiche Geld ist für mich wie die Vermehrung des Ergebnisses eigener Mühen. Im Dunklen bleibt, dass nicht ich, sondern die Tier- und Pflanzengesellschaften des Meeres die Meeresfrüchte produzierten (und die endlose Kette fremder Arbeitsvorgänge, sie schließlich auf meinen Teller platzierten). Wie also soll ich riechen, dass mein Gerechtigkeitsgefühl aus Vorgängen gestrickt ist, die meine Mitmenschen arm und die Meere leer macht?
Geld stinkt nicht, und Frutti di Mare auf der Pizza schmecken nicht nach leer gefischtem Meer. Wir müssen offenbar erst mit der Nase darauf gestoßen werden.
Stinkt Geld doch?
Das geschieht etwa, wenn Greenpeace mit Tausenden der Sommerhitze ausgesetzter toter Fische, Krebse und Muscheln zeigt, dass „eine Politik stinkt, die es zulässt, dass jedes Jahr allein in der Nordsee 700.000 Tonnen Meerestiere als Beifang völlig sinnlos sterben, weil sie nicht einmal im Hafen angelandet, sondern gleich wieder tot oder sterbend über Bord gekippt werden.“
Mit fair Trade zur Mitmenschlichkeit!
Aktionen für ökologisch und sozial verantwortungsvollen Konsum, wie etwa die Kampagne „Augen auf beim Blumenkauf,“ Fair Trade, umweltbewusstes Reisen, oder der Erwerb von Fisch mit Ökosiegel helfen weiter.
Die individuelle zur Kenntnisnahme und Zähmung des inneren Schweinehundes bei jeder Kaufentscheidung, die täglich mehrfache Entscheidung für oder wider höhere Warenpreise, die durch Mehraufwand für zukunftsfähige, faire Produktion notwenig werden, ist notwenig, lehr- und hilfreich.
Verantwortung öffentlicher Beschaffung
Der Effekt wäre größer, würden die öffentliche Hand und andere Großeinkäufer fair und umweltfreundlich einkaufen (müssen). Auch in diese Richtung gibt es viel versprechende Bewegung.
Zukunftsfähiges Nachfragen nach (oder durch) Mindeststandards?
Soziale und ökologische Kriterien bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen oder der Güter-Beschaffung durch die öffentliche Hand wären – insbesondere in Kombination mit der Frage nach der Erreichbarkeit globaler Nachhaltigkeitsziele – ein großer Fortschritt bei der Entwicklung eines hinreichenden Willens zu einer sozial und ökologisch reflektierten Nachfrage nach zukunftsfähigen Formen der Produktion. Denn das Bedürfnis, nach der Zukunftsfähigkeit des eigenen Wohlstands zu fragen, wird sich nur in dem Maße entwickeln können, wie Regeln (und deren Anwendung) mit bestimmt werden können, die das mitmenschliche und ökologisch bewusste Handeln zur Normalität machen. Doch auch eine verantwortlich einkaufende „Öffentliche Hand“ wäre dafür nicht ausreichend.
Grad wo private Konkurrenz ums Schneller und Besser im Wortsinne mörderisch wird und sich die freundliche Dr. Jekyll Gestalt der unsichtbaren Hand privaten Aneignens zur Mr. Hyde Klaue zu formen beginnt, müssen soziale und ökologische Mindeststandards festgelegt werden, die weltweit gültig und deshalb in der Lage sind, Sozial- und Ökodumping durch drohende Sonderabgaben oder auch Verkauf von „Verschmutzungsrechten“ usw. zu verunmöglichen.
Erst die Möglichkeit zur Mitbestimmung sozialer Regeln, gibt (gäbe) Anlass, ernsthaft über die Gerechtigkeit dieser und jener Festlegung zu streiten, stachelt das Verlangen nach Informationen über die Grundlagen der zu treffenden Entscheidungen an, macht jede auch noch so privat erscheinende Nachfrage zu einem Gegenstand öffentlichen Nachfragens.
Erlöse aus „Verschmutzungsrechten“, Öko- und Sozialsteuern und -zölle (oder umgekehrt Gutschriften), die so einen Entwicklungsprozess steuern, müssten allerdings dafür eingesetzt werden, Nationen, Branchen usw., die ihre Konkurrenzvorteil bisher weitgehend aus dem Raubbau bzw. dem Mangel an sozialer und ökologischer Zukunftsfähigkeit gewinnen, den Umstieg in ein zukunftsfähiges (menschenwürdiges und naturverträgliches) Wirtschaften zu ermöglichen.
 (Globale) Notwendigkeiten und (regionale) Möglichkeiten müssen also berücksichtig und finanzielle Mittel wie Maßnahmen zur Förderung nationaler Umbauprogramme so in Zeit und Raum eingeordnet werden, dass auch die sozial und ökologisch problematisch produzierende Nationen in den Prozess einwilligen können. International gültige Mindeststandards und nationale Nachhaltigkeitsstrategien müssten also
(Globale) Notwendigkeiten und (regionale) Möglichkeiten müssen also berücksichtig und finanzielle Mittel wie Maßnahmen zur Förderung nationaler Umbauprogramme so in Zeit und Raum eingeordnet werden, dass auch die sozial und ökologisch problematisch produzierende Nationen in den Prozess einwilligen können. International gültige Mindeststandards und nationale Nachhaltigkeitsstrategien müssten also  Hand in Hand geschaffen und finanziert werden.
Hand in Hand geschaffen und finanziert werden.
Die Herstellung eines solcherart „gemeinsamen Menschheitsgeschichte“ könnte nur als Bündel geschichtlicher Prozesse geschehen, die bestehende oder bereits mögliche Ansätze fortsetzen. Das Kleine (zertifizierte Ökowaren, fair Trade oder freiwilliger Audit) darf aber nicht klein (d.h. auf privaten Goodwill angewiesen) bleiben und es käme darauf an, aus ihnen Regeln zu entwickeln, die aus der sozialen Nische, lebensweltlicher Moden und „Szenen“ heraus führen und auf Veränderungen im Großen und Ganzen abzielen.
Angesichts der rasanten Entwicklung von Nachfragemacht in Ländern wie China, Indien oder Brasilien bleibt für diese „historischen Veränderungsprozesse“ nicht allzu viel Zeit.
hh

Story of Stuff – German from UTOPIA AG on Vimeo.
Den Rest des Beitrags lesen »



 Veröffentlicht von Hans-Hermann Hirschelmann
Veröffentlicht von Hans-Hermann Hirschelmann